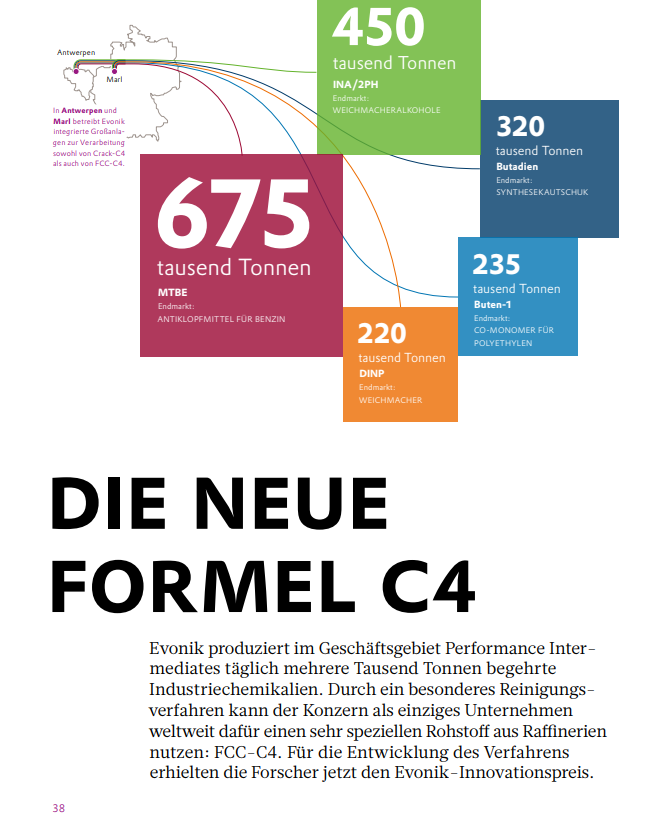Der Journalist Frank Frick hat die Texte des Schwerpunkts „Zeitenwende im Ruhrgebiet“ in der Februarausgabe von „Deutschlands erstem Wissenschaftsmagazin“ geschrieben. Er berichtet darin etwa über den ehrgeizigen Plan, nach dem Aus der letzten Steinkohle-Zeche im Ruhrgebiet auf deren Gelände ein unterirdisches Pumpspeicher-Kraftwerk zu errichten. In einem anderen Artikel stellt der Journalist die Wasserstadt Aden vor, die in Bergkamen entsteht. Ihre Bewohner sollen mithilfe von Wasser aus ehemaligen Bergwerken heizen und kühlen.

Hier ein Ausschnitt aus einem der Artikel des Schwerpunktes:
Energie der Marke Prosper-Haniel
Ein Pumpspeicher-Kraftwerk könnte auf dem Gelände eines Bergwerks in Bottrop regenerativ erzeugte Energie speichern.
„Die Chinesen würden gucken – und sie wären beileibe nicht die Einzigen“, ist Ingenieur André Niemann überzeugt, Professor an der Universität Duisburg-Essen. Das Bauwerk, von dem er spricht, wäre tatsächlich weltweit einmalig. Auf den ersten Blick zu erkennen wäre davon allerdings nur ein etwa 100 000 Quadratmeter großer See. Der Rest läge unter der Erde, in Tiefen bis zu 520 Metern.
Der Ort: das Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop. Im Dezember 2018 wird mit seiner Schließung die Zeit zu Ende gehen, in der die Bezeichnung Kohlenpott für das Ruhrgebiet einen Sinn ergab. Dann wird der schwarze Energieträger nicht mehr aus der Erde geholt. Und es könnte mit einem Bauwerk begonnen werden, dessen Planung weit fortgeschritten ist. Es würde helfen, das schwankende Angebot an „grünem“ Strom – mithilfe von Wind oder Sonne erzeugt – an den stets schwankenden Strombedarf anzugleichen. Das „Untertage-Pumpspeicherkraftwerk“ wäre ein perfektes Sinnbild für die deutsche Energiewende. Und zugleich stände es für den Strukturwandel im Ruhrgebiet. Mehr Symbolkraft geht nicht. Was derzeit noch fehlt, um die fertigen Pläne umzusetzen, sind allerdings Investoren.
Zukunft für Strecken und Streben
Die Idee geht auf das Jahr 2010 und ein kleines Team von Umweltwissenschaftlern an der Universität Duisburg-Essen zurück. Nachhaltigkeitsexperte Ulrich Schreiber bedauerte, dass die bergbauliche Infrastruktur – Schächte, Strecken und Streben – nach und nach einfach aufgegeben wurde. Schließlich hätten sie einen perfekten Zugang zur Unterwelt geboten. Als Geologie-Professor dachte Schreiber zunächst daran, diese Infrastruktur zur Nutzung der Erdwärme einzusetzen. Im Gespräch mit den Kollegen vom Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft um André Niemann kamen die Forscher dann auf die Möglichkeit eines unterirdischen Pumpspeicher-Kraftwerks.
Für ein Pumpspeicherkraftwerk braucht man normalerweise zwei Dinge: einen Berg und Wasser. Denn es besteht aus zwei Becken in unterschiedlicher Höhe, verbunden durch Druckrohrleitungen. Soll elektrischer Strom gespeichert werden, so wird Wasser vom Untersee in das Oberbecken gepumpt. Wird der Strom benötigt, wird das Wasser bergab zurück ins untere Bassin geleitet. Turbinen und Generatoren verwandeln die Kraft des fallenden Wassers wieder in elektrischen Strom.
Berge – und damit vergleichsweise viele Pumpspeicherkraftwerke – gibt es hierzulande vor allem in Süddeutschland, aber auch in den Nachbarländern Schweiz und Österreich. Für die Oberbecken werden manchmal ganze Berggipfel abgetragen. Oft befinden sich Druckrohre und Maschinen im Inneren eines Berges. Insofern ist der gedankliche Schritt von einem herkömmlichen Pumpspeicherwerk zu einer Anlage in einem Bergwerk nicht sehr groß. Statt Wasser von einer Bergspitze abwärts durch den Berg fließen zu lassen und in ein Talbecken zu leiten, kann man im Prinzip genauso gut Wasser von der Erdoberfläche aus in die Tiefe einer Bergwerksgrube fallen lassen.