In der August-Ausgabe von „bild der wissenschaft“ habe ich nachgehakt: Mein Text zeigt, was aus der Superlinse geworden ist – 2008 hatte die Zeitschrift erstmals darüber berichtet. Hier der Artikel in einer Version, die etwas ausführlicher ist als die in bild der wissenschaft.
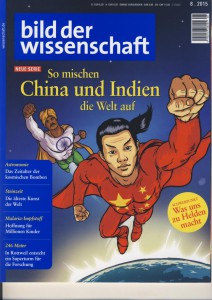
Trübe Aussichten
Keiner hat sie eingesetzt bekommen: die Superlinse.
„Im Jahr 2014 bin ich 68. Dann lasse ich mir das künstliche Akkommodationssystem einbauen“, zitierte bild der wissenschaft in der Ausgabe 11/ 2008 („Die Superlinse“) den Ingenieur Georg Bretthauer. Der damalige Leiter des Instituts für Angewandte Informatik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und durchschnittlich zehn seiner Mitarbeiter hatten 2008 schon einige Jahre an dem System getüftelt, das bei einer kleinen Operation statt der natürlichen Linse ins Auge eingepflanzt werden sollte. Zum einen bei Menschen, die sowieso eine Kunstlinse benötigen, weil der Graue Star ihren Blick trübt. Zum anderen aber auch bei Alterssichtigen, deren Linse beim Hin- und Herschalten zwischen Nah- und Ferndistanz nicht mehr mitkommt. Allen sollte das Implantat helfen, ohne Gleitsichtgläser oder dem ständigen Brillenwechsel im Alltag scharf zu sehen.
Nur Demonstrator IV
Wäre das Implantat heute einsatzbereit, hätte Bretthauer es sich an der Universitäts-Augenklinik Rostock einsetzen lassen, dem medizinischen Partner der Karlsruher Ingenieure. Doch es gibt bislang nur den „Demonstrator IV“. Dieses System ist prinzipiell funktionsfähig – aber: Alle Komponenten sind doppelt so groß, wie sie sein dürften. Tatsächlich hat es sich als sehr schwierig erwiesen, Linsensystem, Antrieb, Sensoren, Regelung, Energieversorgung und Informationstechnik in einem Volumen von lediglich 70 Kubikmillimetern unterzubringen. Dass so wenig „Bauraum“ (Bretthauer) zur Verfügung steht, hatten die Rostocker Mediziner um Rudolf Guthoff erst im Laufe des Projektes erfahren: „Als Rudolf mit der Nachricht kam, dass der Querschnitt des Implantats nur neun anstatt ursprünglich zehn Millimeter sein darf, habe ich ihn gefragt: Weißt Du eigentlich, dass sich der Bauraum mit dem Quadrat des Radius verringert –nicht um rund 10, sondern um fast 30 Prozent?“, erinnert sich Bretthauer.

