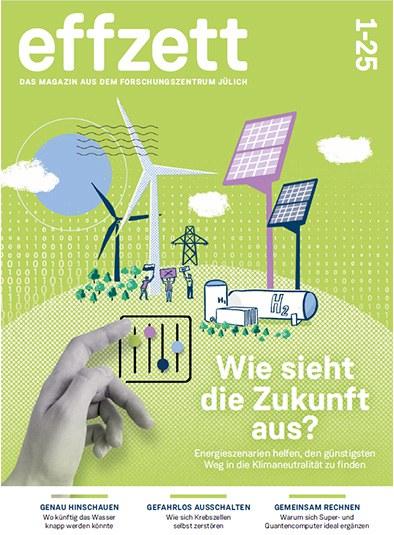Auch dieses Jahr habe ich Gespräche geführt, die als Wortlaut-Interviews veröffentlicht wurden. Erstes Beispiel: „Gemeinsamer innovativer – wie?“ mit Marie Lena Heidingsfelder und Clebens Striebing vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO für das Magazin Carl, S. 38. Zweites Beispiel: „Transparentes Sprachtalent“ mit Stefan Kesselheim und Andreas Herten vom Jülich Supercomputing Centre für das Forschungsmagazin effzett.
Wer solche Interviews liest, könnte meinen, sie seien für die fragende Journalistin oder den Journalisten eine einfache und schnell erledigte Angelegenheit: ein paar Fragen stellen, die Antworten von einer KI transkribieren lassen und den Interviewten zur Durchsicht geben: fertig! So ist es aber nicht.
Vorbereitung: Einlesen in komplexe Themen
Ein paar Fragen zu stellen, mag leicht sein, wenn es um ein Fußballspiel oder einen Augenzeugenbericht geht. Bei Interviews, die ich als Wissenschaftsjournalist über komplexe Themen führe, muss ich mich jedoch oft aufwändig vorbereiten, etwa durch das Lesen wissenschaftlicher Publikationen. Meine Interviewpartnerinnen und Interviewpartner haben weder die Zeit noch die Geduld, mir eine grundlegende, stundenlange einführende Vorlesung zu halten. Interessante Antworten erhalte ich nur, wenn die Fragen an der richtigen Stelle ansetzen und herausfordernd sind.
Trotz Vorbereitung lässt es angesichts der Themen meist nicht vermeiden, was Michael Haller in seinem Handbuch-Klassiker „Das Interview“ schrieb:
„Manches interessante Presse-Interview ist nicht der Erfolg einer fahrplanmäßig abgespulten Befragung, sondern, ganz im Gegenteil, das Elaborat eines sehr langen, vielleicht auch verschlungen geführten Gesprächs.“
Das gilt umso mehr, wenn das Interview mit zwei Personen geführt wird, wie in meinen Beispielen.
Aufwändige nachträgliche Nachbearbeitung
Was das Aufnahmegerät aufzeichnet, muss für ein Print- oder Online-Interview nachträglich „gestaltet“ oder „geformt“ werden. Die Spielräume dafür sind größer als bei einem Interview für Radio, Fernsehen oder Podcast, das allenfalls geschnitten werden kann. Das bedeutet allerdings auch mehr gedankliche Arbeit und Aufwand.
Jeder, der schon mal ein aufgenommenes Gespräch wortwörtlich ins Schriftliche übertragen — oder eine KI dafür angestellt — hat, weiß: Die mündliche Sprache unterscheidet sich stark von der Schriftsprache – und dabei geht es nicht nur um Dialekte oder Ähm`s. Hinzu kommt, dass schon zehn Minuten ungekürztes Interview mindestens 9000 Zeichen ergeben. Die meisten Print-und Online-Medien bevorzugen aber Längen von 3000 bis 6000 Zeichen.
Das bedeutet: Kürzen und überarbeiten — und zwar so, dass die wichtigsten Informationen und Aussagen erhalten bleiben. Dabei darf nichts verfälscht werden und die Interviewten müssen sich im geschriebenen Interview wiederfinden. Gleichzeitig muss des Gesprächs für die Lesenden nachvollziehbar bleiben. Fazit: Ein Print- oder Online-Interview ist für den Journalisten zwar keine Kunst, aber ein häufig unterschätztes Handwerk. Ich habe schon manchen herkömmlichen Bericht schneller geschrieben als ein Interview gleicher Länge gestaltet.